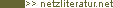
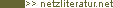 |
| Ich
surfe, also bin ich Das Netz-Buch "Mein Pixel-Ich" von Christiane Heibach
Innovationspreis? Die
in Buchform präsentierten Beiträge lassen den Netzliteratur-versierten
Leser über dieses Wort stolpern, denn eigentlich kommen die Texte
recht konventionell daher. Ein kollektives Sampling von meist ausgesprochen
selbstreflexiven Kurztexten verschiedener Autoren, nach wöchentlich
wechselnden Themenkomplexen geordnet. Auch der Geburtsvorgang der Texte
im Rahmen eines offenen Mitschreibeprojektes im Internet kann nach acht
Jahren World-Wide-Web-Existenz nicht mehr unbedingt als neu bezeichnet
werden. Da kommt man schon eher in die paradoxe Situation, die Veröffentlichung
in Buchform als innovativ zu bezeichnen - im Gegensatz zu den Internet-Ausflügen
von ausgewiesenen Buchautoren wie das von Thomas Hettche initiierte NULL
und Rainald Goetz' Abfall für alle, bei dem die Veröffentlichung
als Buch schon in den Internetbeiträgen vorauszusehen war, ist dies
beim "Pixel-Ich" nicht der Fall. Man merkt dem Buch an, dass es aus dem
Netz kommt, nicht dass das Netz als "Vorveröffentlichungsmedium"
eines Buches gedacht war. Die Herausgeber haben sich auf die Fahnen geschrieben,
möglichst wenig an der Ursprungsform der Texte zu ändern - so
bleibt die Heterogenität der Beiträge erhalten. Und dies ist
tatsächlich in gewisser Weise innovativ (auch wenn es dafür
den Preis eigentlich nicht gab) - und zwar sowohl als literarisches Experiment
als auch als Dokumentation der medialen Verknüpfung von Menschen
durch das Internet.
Doch was dokumentieren die Texte eigentlich genau? Weniger das kommunikative Element des Internet, denn die Beiträge sind nicht auf Kommunikation mit anderen angelegt. Auch nicht das Innovationspotential digitaler Darstellungsformen - weder Hypertext noch Multimedialität noch andere programmbasierte "Gimmicks" werden hier kultiviert. Im Mittelpunkt des Projektes steht - schon thematisch vorgegeben - der Mensch und seine Verknüpfung mit der Medialität des Alltags. Und das ist tatsächlich interessant. Ein Buch über die Auswirkungen eines kommunikativen Mediums auf den Lebensalltag von Menschen - eine Mediengeschichtsschreibung von unten. So habe ich dieses Buch gelesen und so ist es unterhaltsam, manchmal ob der vielen Selbsterforschung auch ermüdend - dennoch hat man als Leser das Gefühl, den Menschen, den Autoren, zum Teil näher zu kommen. Man findet sich wieder in den Alltagsnöten mit dem widerspenstigen Digitalen, leidet mit Betty Bienenstich, die ihren Freund ans World Wide Web verliert, verfolgt Sabrina Ortmanns langen Weg vom Papier zum Internet, von diesem wieder zur leidigen (papierenen) Magisterarbeit, beobachtet Ariane Rüdigers Alltag als Teleworkerin und Thorsten Kettners Identitätssuche. Dazwischen ein paar netzinspirierte Phantasieszenarien: Der Papst als Chatter im Netz, ein Familientreffen im Cyberspace, Romeo und Julia müssen sterben, weil der Service-Provider die entscheidende E-Mail nicht zustellt... Soap Opera im Netz? Reality Literature, garniert mit Phantasien? In gewisser Weise ja, aber auch wieder nicht. Deutlich wird an den Selbstreflexionen der Projektteilnehmer, dass das Internet tatsächlich einen eigenen sozialen Raum etabliert, der mit dem realen Lebensumfeld der Autoren und Autorinnen gleichzeitig konfligiert und korrespondiert. Identitätsspiele im Chat, Kommunikation über Mail, Informationssuche im WWW, diese Tätigkeiten nehmen mittlerweile einen Großteil des Alltags ein - und das Netz macht abhängig. Die Schwierigkeiten des Netzentzuges, der Abnabelung vom Makrokosmos (oder Mikrokosmos?) des Internets, wie sie Mone Hartmann und Triticea alias Caroline Mißbach schildern, hin und hergerissen zwischen Sehnsucht und Erleichterung, sprechen für sich. Dagegen erscheinen die vielen Reflexionen über wechselnde Identitäten (der Thementeil Identität ist der umfangreichste der acht Blöcke) eher bemüht, münden zumeist in allgemeinen Reflexionen über die Konstitution des Ichs (nicht notwendigerweise des Pixel-Ichs) oder den üblichen Phantasien über Rollenspiele im Netz. Man stößt hier auf Probleme, die vielleicht durch das Netz verstärkt werden, im Grunde genommen aber den Charakter einer medienunabhängigen "anthropologischen Konstante" haben - die Suche nach dem Kern der eigenen Identität. Und dies macht eines deutlich: Auch das Netz eignet sich nicht zur Wunschmaschine für eine Alternativ-Existenz, die von der Last des Real-Life befreit - dazu ist es (ein Paradox?) viel zu real. Und so stellt sich das Internet als eine der vielen Wirklichkeiten dar, die man als Berufs-, Familien- und Freizeitmensch sowieso hat. Das Pixel-Ich ist ein Teil des Ichs. Natürlich kann man sich die Frage stellen, inwieweit es sinnvoll ist, ein in und mit dem Internet entstandenes Projekt über das Netzleben in Buchform herauszugeben. Nun, es sprechen einige Gründe dafür: Zunächst einmal der legitime Wunsch der Autoren, vielleicht doch etwas Geld zu verdienen. Lebt das Internet gerade im Kunstbereich von einer Art "Geschenkökonomie", in der weder Künstler noch Schriftsteller finanziell profitieren, liegt es nahe, sich - wenn möglich - des ausgereiften Buchmarktsystems zu bedienen, statt das Netz mit "Zollgrenzen" zu spicken, die nur gegen Zahlung überwunden werden können. Zum zweiten ist es nach wie vor so, dass Bücher sehr viel stärkere Beachtung durch Kritik und Wissenschaft finden als die zensur- und redaktionsfreie Netzveröffentlichung. In einer Zeit, in der Literatur und Wissenschaft sich nach wie vor am medialen Paradigma des gedruckten Buches orientieren, kann ein Buch wie das "Pixel-Ich" durchaus Aufklärungsarbeit leisten und damit das Augenmerk auf die (ästhetischen) Potentiale des Internet lenken. Und zum dritten dokumentiert das Buch etwas, das sonst selten deutlich wird: Der Transfer in das alte Printmedium führt vor Augen, dass Buch- und Netzliteratur in engem Zusammenhang miteinander stehen können - das Schreiben im Netz wird voraussichtlich auch das Schreiben von Büchern verändern. Heterogenität und Stilvielfalt sind Merkmale einer kollektiven Autorschaft, bei der keine vereinheitlichende Glättung vorgenommen wurde, um ein homogenes "Werk" zu kreieren, wie es normalerweise bei kooperativen Schreibprojekten für Bücher passiert - insofern ist das Buch auch eine Dokumentation performativer Sampling-Literatur, die keinen Anfang und kein Ende und schon gar keinen Werkcharakter für sich beansprucht. Das wird unterstrichen durch die Spontaneität vieler Beiträge, die aus dem Moment heraus entstanden sind und denen eine angenehme Unmittelbarkeit innewohnt. Die jüngst entfachte Diskussion über den ästhetischen Wert des "Pixel-Ich" scheint sich dagegen auf einen sehr konservativen, von der Literaturtheorie schon seit längerem kritisierten Literaturbegriff zu orientieren. Denn interessant ist das Buch gerade unter dem Aspekt seiner Entstehungsgeschichte und seiner medialen Umgebung, die sich in den Beiträgen in vielfältiger Form spiegelt. Zudem - und dies ist der Vorteil von Samplings - kann der Leser sich je nach Vorliebe das heraussuchen, was ihm gefällt und anderes überspringen. Die Heterogenität verhindert darüber hinaus zum Glück das exhibitionistische Moment, das Online-Tagebüchern von Einzelautoren häufig anhängt: Von den Pixel-Ichs erfährt man immer nur Splitter, den Rest muss man sich selber denken. Das Buch als Ganzes ist als Dokumentation
des netzverwobenen Alltagslebens daher durchaus nicht überflüssig,
als Sammlung einzelner Texte teilweise amüsant zu lesen, zumal
man - ähnlich wie im Netz - beliebig browsen kann, mal hier und
mal dort herumliest. Außerdem: Was nun eigentlich Literatur ist,
weiß sowieso kein Mensch - erlaubt ist, was Vergnügen bereitet.
Und mir hat das Lesen Spaß gemacht. Sabrina Ortmann/Enno E.
Peter (Hg.) |