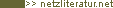
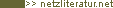 |
| Performativer
Vortrag und Demonstration im Kunstpanoram Luzern am 14.11.2003 Reinhard Döhl, Johannes Auer: Reinhard Döhl:
Es gehört Kunst zum Äpfelbraten (Sprichwort) Als wir Ende der 50/Anfang der 60er Jahre in Stuttgart
versuchten, der konkreten Poesie das Laufen und einer Rechenmaschine das
Dichten beizubringen, geschah dies in einem kultur- und technikgeschichtlichen
Kontext, den wir hier nicht zu erörtern haben.
Die ersten Texte der Zuse Z 22 sind heute Inkunabeln "künstlicher Poesie", die Max Bense kurze Zeit später auch theoretisch von der "natürlichen Poesie" unterschied. Als eine Inkunabel konkret visueller Poesie gilt heute der Apfel  Damals interessierte uns u.a. die Frage, wieweit sich Texte ohne völligen Aussageverlust reduzieren lassen. Wir experimentierten mit 2- bzw. 3-Worttexten, der Art
Oder
Oder mit Bezug auf Gomringer
Zugleich beschäftigte uns das Problem möglicher
Visualisierung solcher "epigramme ad usum delphini", ein Problem,
das ich experimentell 1965 mit der serie "apfel birne blatt"
zu lösen versuchte, mit Arbeiten, bei denen in ein das Figuratum
aufbauendes Wort ein zweites Wort als Fremdkörper eingeschlossen
war.
Diese Figurata waren z.B. als historische Anspielung gedacht, etwa darauf, daß kurz nach Einführung der Guillotine das erste Feuilleton erschien, dem Feuilleton also, wenn man will, von Anfang an die Guillotine eingeschrieben war.  Oder sie waren als literarisches Spiel gedacht, wenn ausgehend von einer Zeichnung Alfred Jarrys, die den berühmt berüchtigten Père Ubu auffällig birnenförmig darstellte,  wenn ausgehend von dieser Zeichnung sich in einer aus "père" addierten Birne ein "ubu" versteckt. Wobei der Anklang mit dem englischen "pear" durchaus eingerechnet war.  Das dritte Beispiel  sollte gleich mehrere Bedeutungsebenen anspielen, von der Redensart "Da ist der Wurm drin" bis zu dem Wissen, daß und wie sehr Äpfel, Wurm und/oder Schlange in der Mythologie in der Regel Verhängnisvolles zur Folge hatten. Auch erotische Konnotationen waren nicht ausgeschlossen.  Während von diesen als Postkarten gedruckten Figurata die Birne und das Blatt weitgehend unbekannt, ihr Anspiel unerkannt blieben, erfuhr der Apfel schnell eine verblüffende Verbreitung, wurde u.a. ins Englische, Französische, sogar ins Isländische  und Chinesische übersetzt,  u.a. in "Harpers Bazar" veröffentlicht, von Rosenthal als Teller aufgelegt und vor allem in viele Schul(lese)bücher aufgenommen. Mit z.T. abenteuerlichen Mutationen,
Dieser Rezeption in z.T. abenteuerlichen Mutationen
auf der einen entspricht auf der anderen Seite eine zwar textgetreue aber
dem Druckbild des Originals nicht entsprechende Wiedergabe, für die
ich kommentarlos zwei Beispiele zeige.
  Auch Kommentare belegten alsbald, wie sehr solche Äpfel Geschmackssache sind, z.B. bei Peter Weiermair: "Der Zeichencharakter der Schrift darf [...] nicht dahingehend ausgenützt werden, den Inhalt des Begriffs naturalistisch zu veranschaulichen; das Verhältnis zwischen Begriff und optischer Präsentation des begriffrepräsentierenden Zeichens sollte vielmehr notwendig ein dialektisches sein. Mißverständlich und als Verdoppelungseffekt erscheint ein naiver Begriffsimpressonismus, wenn zum Beispiel ein Apfel als ikonisches Bild aus Lettern aufgebaut wird, die den Begriff Apfel repräsentieren. Das Bild wirkt durch seine Ähnlichkeit, nicht aber durch seine Idee. Sobald die Identifikation mit dem intendierten Gegenstand erreicht ist, löst sich die Spannung des Lesers und die Aufgabe ist, wie in einem Suchspiel, gelöst." Ein zweiter, von Christian Wagenknechts vorgetragener Kommentar erkennt dagegen auf "sprachliches Vexierspiel", wenn er schreibt: Der Autor verzichte "darauf, die äußere Kontur des Textes gleichsam von innen her, aus der geordneten Wiederholung des einen Wortbildes abzuleiten, sondern" zwinge [...] "dem bedeutungslosen Resultat einer mechanischen Vervielfältigung ebenso mechanisch, mit der Schere, die Kontur eines Apfels auf. Der Autor dürfe sich "freilich [...] die Bequemlichkeit der mechanischen Konturierung gestatten, weil es in seinem Text nicht eigentlich und jedenfalls nicht nur um die typografische Abbildung eines Apfels geht. Dieser Apfel nämlich enthält [...] einen Fremdkörper, genauer: einen Wurm. Und der verbirgt sich nicht wie auf Vexierbildern in fremder Gestalt, sondern überraschenderweise in seiner eigenen, in der des Wortes Wurm [...]. Ein sprachliches Vexierspiel also, ein Scherzgedicht mit den Mitteln der konkreten Poesie, ein Witz, wenn man so will - ein Witz aber, der wie die Wortspiele Nestroys dazu angetan ist, den Betrachter im Labyrinth der Beziehungen zwischen Sprache und Welt zu verfangen." Ich vernachlässige einen dritten Kommentar des Kollegen Ahn Mun-Yeong von der Chungnam National University, "Die poetologische Bedeutung der Konkreten Poesie in zenbuddhistischer Sicht", und notiere, daß die ursprüngliche, die eigentliche
Intention von "apfel, birne, blatt" - grob gerechnet - erstmals
knapp 40 Jahre nach ihrem Druck in Bettina Sorges Nachwort zu einem unlängst
erschienenen "Lesebuch" ausführlicher diskutiert wurde.
Nicht nur der Vollständigkeit halber muß
schließlich noch eine vierte Rezeptionsschiene erwähnt werden:
die des produktiven Umgangs, der spielerischen "Fortführung"
einer Vorlage, für den André Thomkins festgeschrieben hat, daß
Kunst "aus etwas etwas anderes" mache. Auch hier gibt es mehrere
Belege, vor allem im Umfeld der mail art,
z.B. aus Japan von Hiroo Kamimura  oder aus Frankreich von Ilse Garnier  oder von Johannes Auer, der die mögliche Anspielung des Trojanischen Krieges aktualisiert  und damit auf die mythologischen Implikationen des Apfels ebenso verweist wie er ironisch auf das flachsinnige Verständnis, das den Apfel bisher begleitete, zielt, wenn in "worm applepie" ein Wurm sich immer wieder durch den Apfel frißt
und, vollgefressen, zu seiner ursprünglichen Größe zurückverdaut
undsoweiter undsofort. Wie aber auch immer - Rezeption und Verbreitung des Apfels haben ihn nicht nur zu einer Inkunabel konkret-visueller Poesie sondern gleichermaßen auch zu einem Warenzeichen wenigstens für Teile meiner künstlerischen Produktion werden lassen, einer Produktion freilich, mit der ich nichts verdient habe und wohl auch nichts verdienen werde. Woran ich freilich nicht schuldlos bin, interessieren mich, als Anhänger der Copy-Left-Fraktion - im Dreieck zwischen Wissenschaft, Kunst und Literatur - Herstellung und Bedingungen, also die ästhetischen Prozesse und die Diskussion ästhetischer Ergebnisse mehr als ihr Umsatz. Ich nehme also bewußt in Kauf, daß meine Hervorbringungen brotlose Kunst sind. Was mich zu meinem zweiten Stichwort führt: Kunst geht nach Brot.
Eine zugegebenermaßen flüchtige Recherche
im Netz hat unter den Suchwörtern "brotlose Kunst" weit über
2000 Treffer ergeben, zunächst und dominierend eine österreichische
Musikergruppe dieser Firmierung. Aber auch, und das war für mich interessanter,
zwei weitere Hinweise:
· Erstens auf ein "forum für brotlose kunst und deren künstler", das sich "Bkunst" nennt, "weil brotlos und brotlose kunst schon vergeben" waren, aber auch in Unterscheidung zu einer "Akunst", weil die BKunst von Künstlern gemacht wird, "die es sich leisten können, sich und ihre kunstwerke nicht zu vermarkten oder aus anderen gründen dem kunstmarkt fernbleiben." (http://www.bkunst.de/brotlos.html) · Zweitens auf eine Sendung der Deutschen Welle vom 25.09.2003 In ihr referierte Antje Allroggen in der Folge "Alltagsdeutsch (39/03)" unter der Überschrift "Brotlose Künste": "Eine der bekanntesten Mythen in der Kunst ist die Geschichte vom armen Künstler: Er opfert sein Leben für die Kunst - und erhält im Tausch Genie und Unsterblichkeit. Weil der Künstler sich mit diesen Eigenschaften über die Regeln und Normen der Gesellschaft hinwegsetzen kann, besitzt er ein Maximum an Freiheit, das ihm für sein kreatives Schaffen zugebilligt wird. Als Preis verzichtet er dafür auf ein etabliertes und finanziell abgesichertes Leben. Die Vorstellung vom armen Künstler, der sein Leben ganz dem kreativen Schaffen widmet und dafür auf Wohlstand verzichtet, hat sich bis heute gehalten." Der folgende Bericht über die Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn, die erste private anerkannte Kunst-Akademie in Deutschland, die ihre Studierenden zu bildenden Künstlern, Bildhauern, Kunsttherapeuten oder auch Schauspielern ausbildet, interessiert mich weniger. Wohl aber ein von ihr angebotener Aufbaustudiengang unter dem Namen "Kunst im Dialog". Ich zitiere: "Hier wird den angehenden Künstlern die Möglichkeit gegeben, in Kontakt mit Unternehmen zu kommen, die sich zum Beispiel für Kunst-Sponsoring interessieren. So sind in den vergangenen Jahrzehnten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wirtschaft neue Berufsfelder entstanden, die die Arbeitsmarktchancen von Kunststudierenden verbessert haben. Der Brotberuf eines Künstlers muß also nicht immer brotlos sein!" Wenn ich richtig informiert bin, wird eine Verbindung von "brotlos" im Sinne von "arm", "kein Brot bringend" (Grimm) und "Kunst" erstmals im ausgehenden 18. Jahrhundert hergestellt, u.a. bei Christoph Martin Wieland in der Differenzierung von Handwerk und Kunst:
Oder im Gegenteil bei Gotthold Ephraim Lessing, der
in "Emilia Galotti" den Maler Conti kategorisch erklären
läßt:
Kurze Zeit später kommt es in den Künsten
zu Verwerfungen, die ihre Entwicklung aber auch das Verhältnis der
Gesellschaft zu ihren Künstlern und der Kunst bis heute bestimmt haben.
Ich beschränke mich auf Stichworte: An die Stelle eines Schöpfergottes tritt der Künstler als Schöpfer sui generis (vgl. Goethes Prometheus). Dieser Schöpfer sui generis ist nicht nur Genie sondern kann, da er ja aus sich heraus schafft, durchaus Dilettant sein. Was auch ein seit der sogenannten Genieperiode auffälliges Auftreten von Doppelbegabungen wesentlich mit erklärt. Drei Beispiele:
Das setzt sich im bürgerlichen 19 Jahrhundert unter
anderen Vorzeichen fort,
Etwa gleichzeitig beginnt das finanziell erstarkende,
politisch kaum mächtige Bürgertum, sich - "im Zeitalter [ihrer]
technischen Reproduzierbarkeit" - auf seine Weise der Kunst zu bemächtigen,
sie in Form von Reproduktionen in die gute Stube zu hängen oder als
Nippesfiguren aufzustellen. Für die Venus von Milo ironisiert dies
schon Keller
Bist, Ärmste, du jetzt in der Mode Und stehst in Gips, Porzlan und Zinn Auf Schreibtisch, Ofen und Kommode. Die Suppe dampft, Geplauder tönt, Gezänk und schnödes Kindsgeschrei; An das Gerümpel längst gewöhnt, Schaust du an allem still vorbei. [...] Gegen diesen bürgerlichen Mißbrauch von Kunst,
gegen ein solches Kunstverständnis richtet sich unter anderem die Kunstrevolution
zu Beginn des 20 Jahrhunderts: "Der Dadaismus hat die schönen Künste überfallen. Er hat die Kunst für einen magischen Stuhlgang erklärt, die Venus von Milo klistiert und 'Laokoon & Söhnen' nach tausendjährigem Ringkampf mit der Klapperschlange ermöglicht, endlich auszutreten." Man würde Arps Dadaspruch mißverstehen, läse man in ihn als Ikonoklasmus, als einen direkten Angriff auf die massenhaft begafften Ausstellungsstücke des Louvre und des Vatikan. Sie sind durch ihn allenfalls vulgarisiert. Die Stoßrichtung des Überfalls ist vielmehr die bürgerliche Rezeption eines postulierten Kunstschönen, die Destruktion erfolgt in Hinblick auf die Überheblichkeit und Anmaßung des bürgerlichen Konsumenten und seines Kunstverständnisses und Kulturbetriebs. Deutlicher noch läßt sich dieser Affront gegen bürgerlichen Mißbrauch von Kunst an einem zweiten, nun nicht mehr nur verbalen Überfall auf die schönen Künste zeigen: an einem ready made Marcel Duchamps. Zielte Arps Definition des Dada konkret auf zwei der populärsten Plastiken, zielt Duchamps ready made auf eines der populärsten Bilder des Abendlandes, indem Duchamp der (in zahlreichen Drucken und auch sonst kunstgewerblich popularisierten) Mona Lisa einen Schnurr- und einen Ziegenbart attribuierte und dem derart verfremdeten Bild zusätzlich mit L.H.O.O.Q ein obszönes Wortspiel unterschrieb, das eine dem Arpschen Klistier durchaus vergleichbare Funktion hat. · Nämlich: in der Potenzierung des Unsinnigen die kultische Institutionalisierung eines Kunstwerks und seine kunstgewerbliche Multiplizierung in Frage zu stellen. Die gelegentlich anzutreffende Auffassung, es handle sich bei diesem ready made nur um eine Persiflage, greift zu kurz. Wesentlich aufregender ist Duchamps späterer Hinweis auf die zeitliche Nachbarschaft seines ready mades zu Sigmund Freuds "Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci", 1910, ²1919. Auch wird gerne unterschlagen und nicht bedacht, daß Duchamp seinem ready made 1965 ein "L.H.O.O.Q. rasée" folgen läßt. 1886 tritt Vincent van Gogh in Bruder Theos Erdgeschoß,
kaut auf einem Kleeblatt und sinniert über die vorbildliche Tragik
seiner künstlerischen Existenz.
Einfache Mathematik denkt Vincent: "Minus und Plus heben sich auf"
und verwandelt mit Schlitzohrigkeit das Positive ins Negative und multipliziert
zur künstlerischen Potenz:
Und seither scheint "Armut" als eine der
notwendigsten Bedingungen künstlerischen Schaffens...
Marcel Duchamp versuchte 1924 diesem Dilemma zu entgehen. Er hatte die Idee, um an Geld zu kommen, 30 handsignierte Aktien, genauer Obligationen, auszugeben für die er eine jährliche Dividende von 20 Prozent zusagte. 
Der Kauf des Papiers war eine Investition in das
von Duchamp entwickeltes System zur "Ausbeutung" von Roulette
aufgrund von mathematischen Berechnungen. Marcel Duchamp erkannte jedoch
schnell die Grenzen dieser Idee:
"Leider war das System zu langsam, um auch nur
den geringsten praktischen Wert zu haben, denn ich musste manchmal eine
halbe Stunde warten, bis in der Abfolge von Schwarz und Rot die günstige
Figur auftauchte. Und die wenigen Wochen, die ich in Monte Carlo verbrachte,
waren so langweilig, dass ich es bald aufgab (...) "
[Marcel Duchamp, hrsg. vom Museum Jean Tinguely Basel, 2002, S. 96] Als die eigentlichen Finanzgenies erwiesen sich die
Nichtkünstler:
"Wenn jemand Kunstkuriositäten als Investition
kauft, so besteht hier die Gelegenheit, in ein vollkommenes Meisterwerk
zu investieren. Marcels Signatur ist allein viel mehr wert als die 500
Franc, die für die Anleihe verlangt werden", schrieb Jane Heap
in der Little Review.
[zit. nach: Calvin Tomkins: Marcel Duchamp. Eine Biographie, Wien 1999, S. 305] Das künstlerische "Spiel" mit Wertpapieren
findet sich seither immer wieder, selten einmal finanziell erfolgreich,
wie beispielsweise die "Dollar Bills" (ab 1962) von Andy Warhol.
In der Regel sind solche Aktionen als Kunst gemeint
und damit, nach der "van Gogh-Formel" zuverlässig finanziell
erfolglos, wie beispielsweise die Ethik-Aktien des Künstlerduos A.S.
Wünkhaus und Rudi Frings von 1994, eine Aktion, die die Zeitschrift
"Kunstforum international" trocken bilanzierte:
[Kunstforum international, Bd. 149, Januar bis März 2000, S. 90] Ein Diktum, das wohl auch leider für die in letzten
Jahr begonnene Aktion des Münsteraner Künstlers Ruppe Koselleck
gelten muss: Koselleck erklärt, die Aktienmehrheit von der Ölfirma
BP sukzessive übernehmen zu wollen. Finanzmittel sind Teerklumpen,
die er an der Nordsee aufsammelt und die sonst unter den Füßen
der Badegäste zu kleben pflegen. Koselleck verpackt den Teer und bietet
ihn als "Teerarium" , als Ready Made zum Kauf an. Preis ist der
aktuelle Tageskurs des BP Wertpapiers.
 Mit dem eingenommenen Geld kauft Koselleck den Konzern
Aktie um Aktie, verleibt ihn sich also, über dessen eigenen Müll,
nach und nach ein. Das Ganze geschehe, wie er ausdrücklich angibt,
"aus ästhetischen Gründen". [http://www.fylmklasse.de/bfdm/index_bp.htm] Wie konnte nun aber die künstlerische Dividende
des Umdenkens, die das "Kunstforum" so wertschätzt, wie konnte
die künstlerische Kreativität kostenfrei ins Internetzeitalter
gerettet werden. Schließlich drohten doch Künstler und Literaten
damit einfach am Kunst- und Buchmarkt vorbei ihre Werke über Internet
selbst zu vermarkten, so das Armutsgebot van Goghs außer Kraft zu
setzen und richtig Geld scheffeln zu wollen. Wie konnte man dieser Gefahr
also entgehen?
Man erklärte einfach, dass für das Netz eine andere Ökonomie gelte, in der es nicht mehr um Geld sondern um Aufmerksamkeit gehe. Michael H. Goldhaber erklärte 1997:
[http://www.heise.de/tp/deutsch/special/eco/6195/1.html] Und das neue Eigentum dieser Ökonomie ist
die Aufmerksamkeit, die der "Besitzer" von anderen erhält.
So fließt also nicht Information durch das Internet, sondern Aufmerksamkeit.
Und immer, wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas richtet, beispielsweise
auf einen Text oder ein Bild, richtet sich diese auch auf den Erzeuger des
Werks. Und es ist knapp, dieses neue Gut Aufmerksamkeit:
"... es geht um etwas, das vorhanden sein muß,
wenn Informationen überhaupt einen Wert haben sollen. Es ist etwas,
das ebenso knapp wie begehrenswert ist, so daß es ein klares Motiv
gibt, sich anzustrengen, um es zu erlangen. Und eben das ist Aufmerksamkeit."
[http://www.heise.de/tp/deutsch/special/eco/6195/1.html] Wenn es gelingt, besonders viel Aufmerksamkeit auf sich
zu lenken, wird man zum Star mit der Möglichkeit, noch mehr "Aufmerksamkeit
zur erhalten und sie beliebig umzulenken" [http://www.heise.de/tp/deutsch/special/eco/6195/1.html].
Denn dieser Wertstoff Aufmerksamkeit kann weitergegeben werden, beispielsweise im World Wide Web durch die Hyperlinks. Oder ganz einfach dadurch, dass ein Star etwas bestimmtes trägt (so funktioniert beispielsweise alle Sportschuh-Werbung). Die Macht des Stars ist dabei die Vermittlung von, wie Goldhaber es nennt, "illusorischer Aufmerksamkeit". D.h. wenn der Star den Fan vom Bildschirm her anblickt, empfindet der Fan die Illusion, Aufmerksamkeit zu erhalten und ist dankbar. Oder wenn er den Turnschuh des Idols trägt, partizipiert er vermeintlich an dessen Aufmerksamkeitsreichtum. Kurz: "In der neuen Ökonomie bedeutet der Sachverhalt,
ein Star zu sein, auch Reichtum und Macht zu haben." [http://www.heise.de/tp/deutsch/kolumnen/gol/2841/1.html]
Auf diesen Gedanken waren 1977 schon die Neoisten gekommen.
David Zack und Al Ackerman propagierten das "Open Pop-Star" Konzept.
Die Idee war es den erfundenen Namen " Monty Cantsin" für
alle zur freien Nutzung zur Verfügung zu stellen.
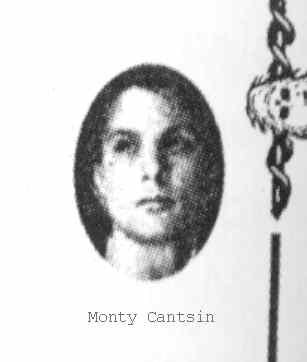
[Oliver Marchart: Neoismus, Wien 1997, S. 15] Oder aufmerksamkeitsökonomisch gesprochen: der
Aufmerksamkeitsreichtum der Kunstfigur Monty Cantsin sollte allen zur Verfügung
stehen.
Trotz beträchtlicher Anstrengungen wurde Monty Cantsin jedoch nur in Insiderkreisen bekannt, war also aufmerksamkeitsökonomisch ein Reinfall. Jedoch selbst wenn es Netzkünstlern gelingt große Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und das war beispielsweise 1997 bei der Kassler Documenta der Fall, bei der zum erstenmal Netzkunst gezeigt wurde, selbst dann bleibt der finanzielle Erfolg bescheiden. Und das obwohl "herkömmliche" Künstlern mit einer Documenta Teilnahme geradezu zwangsläufig finanziell ausgesorgt haben. So resümiert der Netzkünstler Joachim Blank 2001 denn auch:
[http://www.malweiber.de/news/netzkunst.htm] Und so erweist sich die Aufmerksamkeitsökonomie
für die Netzkunst als idealer Weg zurück in die van Gogh'sche
Falle: Aufmerksamkeit - ja, Geld daraus machen - nein. Na selbst schuld, möchte man rufen, bei der grossen Affinität der Netzkunst zu Open Source und Open Culture - kurz dem ganzen Umkreis der Geschenkökonomie. Jedoch keine Regel ohne Ausnahmen und so will ich zum
versöhnlichen Abschluss 2 Netzprojekte mit positiver Bilanz vorstellen.
Nizza: 26.06.2001Beide spielen um den Jahreswechsel 1999/2000, dem goldenen Zeitalter der New Economy, als Startup noch ein Zauberwort und E-commerce der Zauberstab war. Ende 1999 kam es zu einem spektakulären Show-down im Netz zwischen der Künstlergruppe Etoy und dem Online-Spielzeugshop eToys.  Der Spielzeughändler hatte die Künstlergruppe auf Aufgabe des Domainnamens etoy.com verklagt. Offensichtlich fürchtete die Firma die künstlerische Verstörung von Kunden, die sich bei Eingabe der URL um ein s vertippten (die Firmendomain hieß eToys.com). So gross war diese Angst, dass sie den Künstlern zunächst für den Domainnamen 400 000 Dollar anboten, was diese aus künstlerischen Gründen ablehnten. Das Gericht in Kalifornien entschied zugunsten der Firma, obwohl diese ihren Domainnamen erst 2 Jahre nach der Künstlergruppe registrieren hatte lassen und die Machtfrage zwischen Kunst und Kommerz schien wieder altbekannt beantwortet zu sein. Jedoch begann jetzt das Erstaunliche: die Aufmerksamkeit der Netzkultur-Aktivisten richtete sich gegen die Firma, der Toywar wurde ausgerufen.  Ziel war es, im Vorweihnachtsgeschäft durch virtuelle Sit-ins, Email-Kampangen und Präsenz in Investorenforen möglichst viel negative Aufmerksamkeit auf eToys.com zu lenken. Und somit den Aktienkurs des virtuellen Versandhauses zu drücken. Die Aufmerksamkeitsökononie bewies in diesem Fall ihre volle Gültigkeit. Kann positive Aufmerksamkeit Starruhm und Reichtum begründen, so zeigte die negative Aufmerksamkeit zur Zeit des irrationalen Börsenhypes ihre Allmacht: tatsächlich gelang es den Börsenkurs von eToys zu halbieren und das, wie es der Konstanzer Netzwissenschaftler Reinhold Grether alias Toywar-Agent NASDAQ beschreibt mit geradezu archaischen elektronischen Mitteln:
[http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/5768/1.html] "Summa summarum verlor der Börsenwert in den 81 Tagen der Kampagne 5 Milliarden Dollar. Toywar war die teuerste Performance der Kunstgeschichte." [http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/sa/8090/1.html] E-commerce muss sich aber nicht nur gegen Kunst richten, sondern kann auch der Gegenstand eines Netzkunst-Projektes sein. So dachte ich zumindest im Herbst 1999 als ich mit meinem Webshop "Fabrikverkauf" [http://www.fabrik-ver-kauf.de] online ging.  Aus heutiger Sicht muss man sicherlich bilanzieren, dass E-commerce und Internetkunst bzw. E-commerce als Anlass oder Material eines Netzprojektes seinen Produktzyklus, seinen Hype hinter sich hat und als Thema für ein neues Projekt verbraucht und ausreflektiert ist. Anders um den Jahreswechsel 2000, als die New Economy noch im vollen Glaubensafte stand, als noch große Spielzeugkriege riesige dot-com Konzerne geschleiften. Lassen sie sich also von mir noch einmal ins goldene Zeitalter der New Economy mitnehmen. Doch bevor ich wieder historisch werden, werde ich, tief in die geschichtliche Namenskiste greifen, um ihnen die 41/2 Paten des Netzkunst-Projektes "Fabrikverkauf" vorzuführen. Denn Kunst hat, wie wir wissen, immer Vergangenheit. Davor, Verständnis halber, kurz 2 Sätze zum Projekt. Fabrikverkauf nimmt die Affirmation von "community" und "E-commerce" zum Anlaß einer vom Nutzer selbst zu gestaltenden Kunstperformance, der [walking exhibition]. Dazu muß der Kunde via Internet im e-shop von "Fabrikverkauf" ein T-Shirt bestellen, das mit von mir entworfenen Kunstmotiven bedruckt ist. Mit Lieferung des T-Shits erhält der Käufer gleichzeitig ein Passwort, mit dem er sich auf der Web-Site von "Fabrikverkauf" einloggen kann, um dort öffentlich zu machen, wann und wo er das T-Shirt, tragen wird, wo die von ihm am Leib getragen Kunst, die Ausstellung, die er damit durchführt, also sein Termin der [walking exhibition] zu besichtigen ist. 
art wear: "worst case" Valerie Donélian - 26.06.2001 um 17:05:02 - Wer außer mir ist nun für dieses Projekt
mitverantwortlich, welche Familienbande sichern es historisch ab? Taufpate ist natürlich Andy Warhol. Verkauf von seriell gefertigten populären Fertigprodukten wird auf immer mit seinem Namen verbunden sein. Ich zitiere Beat Wyss aus seinem passend genannten Buch 'Die Welt als T-Shirt': "Täglich ereignet sich die Epiphanie von Andys Geist in allen Supermärkten (bitte gedanklich e-shops ergänzen, J.A.) der Welt: Die mythische Einheit von Ware, Werbung und Kunstform in Realpräsenz! Die Prophetie der Avantgarde hat sich erfüllt: Kunst ist lebend geworden und wohnt jetzt mitten unter uns" (WaT, S.117). Und so ist Fabrikverkauf ein namentlicher Kniefall, na sagen wir Knicks vor Andys Factory. Knicks, weil wir in Andys Familiengeschichte natürlich sofort auf seinen Großonkel treffen, von Beat Wyss, wie eben zitiert, die "Prophetie der Avantgarde" genannt. Prophet Marcel für Beat Großonkel Duchamp für Andy prophetischer großer Patenonkel Marcel Duchamp für Fabrikverkauf. Danke Onkel fürs ready made! Auch wenn's die Aura verloren hat. Recht hat Großpate Benjamin: wenns technisch reproduziert wird, geht beim Kunstwerk die Aura flöten - auch bei einem T-Shirt. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Wer will sich schon ein auraloses Mehrfachkunststück ins Haus holen und dafür auch noch bezahlen? Sorry Walter, da müssen wir ein wenig trixen und an die Aura des T-Shirt Trägers ran. Und da bist du selbst Schuld: hast du, Walter, nicht gesagt, dass - ich zitiere dich wörtlich - "jeder heutige Mensch einen Anspruch vorbringen (kann), gefilmt zu werden" (I, 2, 493) kurz das Recht hat, für 15 Minuten ein Star zu sein, wie das Andy griffiger formulierte? Also, wird nicht durch das Tragen des T-Shirts die Aura des reproduzierten Kunstwerks wiederbelebt, indem sie quasi parasitär an der Infusion der temporären Star-Einzigartigkeit des Trägers hängt, an die dieser natürlich fest glaubt? Der T-Shirt -Träger, das ist der Trick, macht ja erst die Kunst, wenn er die [art wear], also das T-Shirt, in der [walking exhibition] ausstellt. Außerdem wird hier das Open-Popstar Konzept zum Open-T-Shirt Projekt gewandelt. D.h. der Träger erträgt geballte illusionäre Aufmerksamkeit, sobald er in das Wäschestück schlüpft und somit zum Aussteller und Kunstobjekt meiner Gnaden mutiert. Und so ein getragenes T-Shirt, das liegt ja direkt auf der Haut, streichelt und massiert sie sanft mit jeder Bewegung, gerade so wie das Stiefonkel Marshall McLuhan gesagt hat: "the medium is the massage". Wir wissen von dieser genealogischen Beziehung Dank eines Hinweises von Reinhard Döhl. Zum familiären Abschluß noch im Vorbeiflug ein Blitzbesuch bei Lieblingsonkel Beuys, der macht es uns leicht, dessen anglisierte Namensanmutung (buys) bindet ihn eh dicht ans Projekt. Außerdem hat er uns die soziale Plastik geschenkt. Und da wollen wir uns ganz artig mit der [walking exhibition] bedanken. "Fabrikverkauf" ist ein hybrides Projekt: findet als e-shop und Commuity-Plattform im Internet statt und hat eine starke real-life-Komponente in der [walking exhibition]. Die [walking exhibition] ist sozusagen der traditionelle Ausstellungsarm des Projektes. Und Ausstellungen werden herkömmlich mit Einladungskarten beworben und mit Reden eröffnet. Folglich wurde auch für "Fabrikverkauf" ein Einladungskärtchen entworfen, gedruckt und verschickt. Passend zu einem E-commerce-Vorhaben in Form eines Dollars.  Die Rede zur Ausstellungseröffnung besorgte Reinhard Döhl ohne zu reden, denn sein Text wurde, wie auf der Einladungskarte angekündigt, Tag gerecht im Internet veröffentlicht. Und natürlich läuft so ein Projekt nicht von allein, da sei Vincent vor, aber in den märchenhaften Zeiten des Internet-Hypes kann es geschehen, dass ein Wochenmagazin wie der SPIEGEL auf solch ein Projekt aufmerksam wird und eine ganze Seite darüber schreibt (DER SPIEGEL, 1/2000, S.173):  Kurz: Der SPIEGEL mit seinen 6 Millionen Lesern lenkte den Wertstoff Aufmerksamkeit geballt auf mein Projekt, der Verkauf florierte und die [walking exhibition] zeigt bis heute kontinuierlich ihre Exponate. Und die Moral von der Geschichte: der Kunst
hilft nur und selten das Glück, ansonsten ist sie arm dran.
|
|
©
Copyright (c) 2003 by |