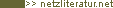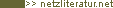Vortrag in der Reihe "Tell.net" der Stadtbücherei Stuttgart am
10. Oktober 2002
1. Medien und Kultur
2. Die Stärken des Netzes
3. Netzkunst I:
Produktionsästhetik
4. Netzkunst II: Darstellungsästhetik
5. Netzkunst III: Medienästhetik
6. Oszillation als kultureller Prozess
1. Medien und Kultur
Kommunikations- und Informationstechnologien entwickeln sich - wie
der spanische Soziologe Manuel Castells in seiner umfassenden Untersuchung
"Die Netzwerkgesellschaft" feststellt - niemals unabhängig
von den gesellschaftlichen Bedingungen.[1]
Die vergangenen Jahrhunderte waren geprägt von zwei unterschiedlichen
Typen von technischen Medien: Auf der einen Seite stehen die individuellen
Kommunikationsmedien wie Telephon und Telefax, die zwei Gesprächspartner
miteinander über Raumgrenzen hinweg verbinden; auf der anderen Seite
findet man die massenmedialen Informationsmedien, die durch eine weitgehend
klare Sender-Empfänger-Struktur geprägt sind - zu ihnen gehören das
Buch sowie Radio, Film und Fernsehen. Mit dieser medialen Zweiteilung
gehen bestimmte kulturelle Paradigmen einher: Wie der Medienphilosoph
Marshall McLuhan in seinen Essays immer wieder betont hat, verändert
jedes neue Medium die Gesellschaft grundlegend, andererseits jedoch
führen bestimmte Bedürfnisse dazu, dass sich neue Medien überhaupt
erst durchsetzen.[2] Medien und Gesellschaft
stehen in einem engen evolutionären Zusammenhang.
Analysiert werden können diese Entwicklungen jedoch meist erst, nachdem
sich ein Medium kulturell etabliert hat. Für die Erfindung des Buchdrucks
ist dies z.B. eingehend untersucht worden.[3] Sie hatte weitreichende
Konsequenzen für die Formen der Kommunikation und der Wissensvermittlung
der westlichen Gesellschaft. So wurde die mündliche, hierarchisch
organisierte Weitergabe von Wissen über direkte Kommunikation, wie
sie im Mittelalter vorherrschte, abgelöst durch interaktionsarme Formen
der Kommunikation. Dafür waren jedoch grundlegende kulturelle Veränderungen
vonnöten: Die Möglichkeiten des Buchdrucks lösten z.B. das Wissen
von der Überlieferung ab. Galt im Mittelalter nur das als Wissen,
was über autorisierte Quellen überliefert war, wurde durch die Massenproduktion
von Büchern das Wissen autonom, löste sich von göttlichen Autoritäten
und machte den Menschen zur Wissensquelle: Der individuelle Autor
wurde geboren.[4] Damit jedoch
das individuelle Wissen an andere vermittelt werden konnte - noch
dazu über eine sehr interaktionsarme Kommmunikationsform - mussten
jedoch erst Standards entwickelt werden: Wie erklärt man z.B. die
Geheimnisse der Pflanzenkunde, ohne dass derjenige vor einem steht
und man ihm die Pflanzen zeigen kann? Also musste die eigene Wahrnehmung
so objektiviert werden, dass sie von anderen nachvollzogen werden
konnte: sowohl in Beschreibungen als auch in Abbildungen, die nach
bestimmten, erst zu entwickelnden Kriterien aufgebaut waren - die
Zentralperspektive setzte sich durch,[5] Kategorisierungs-
und Klassifizierungskriterien mussten entwickelt werden. Die Rezipienten
wiederum waren gezwungen zu lernen, mit diesen Standards umzugehen.
Was für uns heute selbstverständlich ist - z.B. die Gliederung eines
Sachbuchs durch Inhaltsverzeichnis, Kapitel, Überschriften, Indizierungen,
aber auch Abbildungen mit Beschriftungen etc., bildete sich
erst in einem langwierigen Prozess heraus. Somit hatte der Buchdruck
sowohl kulturelle Veränderungen in bezug auf die Wahrnehmungsformen
als auch auf die Kommunikationsformen zur Folge. Wissensvermittlung
fand nicht mehr primär im face-to-face-Gespräch statt, sondern im
interaktionsarmen Medium Buch - und das hat sich bis heute nicht geändert.
Die Durchsetzung eines Mediums geht dann einher mit der Prämierung
bestimmter Formen der Kommunikation und der Informationsgenerierung,
-darstellung und -verarbeitung. Dass die westliche Gesellschaft das
Buch nach wie vor als Hort der Bildung und als paradigmatische Form
der Wissensvermittlung ansieht, zeigte sich erst jüngst in den Diskussionen
um die Ergebnisse der PISA-Studie. Nach wie vor beherrschen die Standards
der massenmedialen Kommunikation und Wissensvermittlung die Gesellschaft,
während die Formen der individuellen interaktionsintensiven Kommunikation
eher in den Hintergrund gerückt sind bzw. andere Funktionen, meist
privater oder inoffizieller Natur, übernommen haben.
Welche Rolle spielt nun das Internet in diesem etablierten Medienverbund?Zweifellos
steht es derzeit erst am Beginn seiner Entwicklung. Dennoch scheint
sich abzuzeichnen, dass es - ähnlich wie damals der Buchdruck - grundlegende
Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation zeitigen könnte.
Dass Manuel Castells seinem Kompendium den Titel "Die Netzwerkgesellschaft"
gegeben hat, leitet sich aus dieser zu beobachtenden Tendenz ab. Auch
die Rede von der Informationsgesellschaft, oder richtiger: von der
informationellen Gesellschaft, die der Industriegesellschaft als Alternative
gegenübergestellt wird,[6] hängt eng
mit der Entwicklung dieses neuen Mediums zusammen.
Tatsächlich unterscheidet sich das Netz grundlegend von den bisher
bekannten technischen Medien: Zunächst ist es sowohl ein Kommunikations-
als auch ein Informationsmedium, arbeitet aber unter anderen Bedingungen
als die etablierten Medien. Aufgrund seiner dezentralen Struktur gibt
es prinzipiell keine Beschränkungen und Kontrollmechanismen, was die
individuelle Nutzung betrifft. Das vielleicht grundlegendste Merkmal
besteht darin, dass eine Rollenflexibilität gewährleistet wird: Wer
empfängt, kann gleichzeitig auch senden und umgekehrt. Diese Offenheit
steht völlig gegen die Prinzipien, die die klassischen Massenmedien
etabliert haben; ebensowenig wie sie den Regeln der individuellen
Kommunikationsmedien entspricht, die stets einen Charakter von privater
Adressiertheit haben (auch wenn sie beruflich genutzt werden). Das
Netz macht einerseits die Kommunikation öffentlich, individualisiert
aber andererseits die Informationsflüsse - mit möglicherweise weitreichenden
kulturellen Konsequenzen.
Ähnlich wie beim Buchdruck - bei dem es ca. 100 Jahre gedauert hat,
bis sich die Gestaltungsstandards herausgebildet haben, die wir bis
heute kennen - lässt sich jedoch beobachten, dass es massive Schwierigkeiten
bei der konkreten Ausgestaltung der spezifischen kulturellen Funktionen
des Internets gibt. Wer kennt nicht die Klagen (und hat auch schon
zeitweise in diese eingestimmt), die sich z.B. mit dem Informationsangebot
des World Wide Webs verbinden: Mangelnde Strukturierung der Informationsmenge,
fehlende Qualitäts- und Kontrollkriterien, unübersichtliche Navigationen,
schlecht gestaltete Webseiten, fehlende technische Standards in bezug
auf Software (man denke nur an die unzähligen Plug-Ins, die notwendig
sind, um avanciertere Webseiten zu betrachten), usw. Auch die Kommunikationsmöglichkeiten
sind letztlich noch ausgesprochen reduziert. Diese Mängel bestehen
- kein Zweifel. Doch sie stellen vermutlich nicht das Medium Internet
in Frage, sondern deuten darauf hin, dass wir es bisher noch nicht
die notwendigen Kompetenzen herausgebildet haben, um den Anforderungen,
die das Medium an uns stellt, gerecht zu werden - ja, zum Teil wissen
wir bisher noch nicht, welche kulturelle Funktion das Netz überhaupt
in Zukunft übernehmen kann.[7] Damit das Internet
tatsächlich verändernd auf die Kultur einwirken und eine Netzwerkgesellschaft
entstehen kann, muss es sich so etabliert haben, dass seine Stärken
voll entwickelt und gesellschaftlich akzeptiert werden. Erst dann
können Oszillationsprozesse in Gang gesetzt werden, die verändernd
auf die Gesellschaft wirken - darauf komme ich später nochmal zu sprechen.
2. Die Stärken des
Netzes
Die Stärken des Internets liegen - wie schon oben angedeutet - einerseits
in seinen Kommunikationsmöglichkeiten, die extrem schnell - entweder
synchron oder asynchron - funktionieren, und die sowohl bidirektionale
Individual- als auch polydirektionale Gruppenkommunikationsformen
ermöglichen. Andererseits ist das Netz auch ein Informationsmedium,
das den schnellen Zugriff auf Datenmengen erlaubt, die mit den Möglichkeiten
des Mediums dargestellt und organisiert werden können, woraus neue
Dateninterpretationsformen hervorgehen. Beide Eigenschaften jedoch
entwickeln andere Charakteristika als wir sie aus den traditionellen
Medien kennen, da die Struktur des Mediums andere Anforderungen stellt.
Vernetzte Kommunikation
Die zeit- und ortsunabhängigen, bi- oder polydirektionalen
Kommunikationsmöglichkeiten führen dazu, dass Computernetzwerke für
die gemeinsame, dezentral organisierte Arbeit zwischen Menschen an
verschiedenen Orten genutzt werden. In Unternehmen gewinnen Formen
der vernetzten Kooperation zunehmend an Bedeutung, die Forschung und
Entwicklung für Software-Programme, die dies möglichst effektiv und
komfortabel gestalten sollen, läuft auf Hochtouren. Im World Wide
Web gibt es noch nicht allzuviele Möglichkeiten, vernetzt zu arbeiten
- dies ändert sich langsam. Web-Logs ermöglichen eine relativ offene
Form der Kommunikation, indem Kommentarfunktionen angeboten werden
oder von vornherein offene Blogs eingerichtet werden, an die jeder
eine Nachricht schicken kann. Sie sind ein gutes Beispiel für die
Tendenz, Individual- oder Gruppenkommunikationen öffentlich zu machen.
Noch interessanter erscheinen mir jedoch die Möglichkeiten, die durch
Wiki-Server eröffnet werden: Wiki-Webseiten
können zur Bearbeitung für alle freigegeben werden. Mit ein klein
wenig Einarbeitung kann dort jeder seine Informationen und Kommentare
hinzufügen und die Seiten bearbeiten, ohne dass die Veränderungen
personell gekennzeichnet werden.
Diese Formen der Kommunikation und der Kollaboration
scheinen die Stärken der Computernetzwerke auszumachen. Jedoch wird
relativ schnell deutlich, dass die Netzkommunikation - verglichen
insbesondere mit der face-to-face-Kommunikation - extrem reduziert
ist. Der Code, über den Kommunikation im Netz nach wie vor in den
meisten Fällen läuft, ist die geschriebene Sprache. Weder hört man
die Stimme des anderen noch nimmt man ihn in seinem Mimik, seiner
Gestik, seiner Stimmmodulation wahr. Insbesondere bei der Bearbeitung
komplexer Aufgaben ist dies von Nachteil. Ganz deutlich wird die noch
unausgereifte Technologie am Beispiel von Gruppenchats. Die Darstellung
der einzelnen Beiträge erfolgt streng linear, je nach Zeitpunkt des
Eingangs, ohne dass darauf Rücksicht genommen wird, wer auf welche
Aussage reagiert hat. Das macht Chats für Beobachter, aber auch für
Beteiligte häufig unübersichtlich und schwer nachvollziehbar.
Derartige Nachteile verdeutlichen, dass wir mit der Entwicklung der
Möglichkeiten erst am Anfang stehen. Paradigmatisch für die Gestaltung
der Kommunikation und auch der technischen Hilfsmittel sind hier häufig
noch die alten Medien - die Prinzipien des face-to-face-Gesprächs
oder der Briefkommunikation werden ins Netz übertragen. Erst langsam
bilden sich eigene Formen heraus - am weitesten fortgeschritten ist
dies wohl bisher im Bereich der E-Mail, in der es mittlerweile von
den Benutzergemeinden gesetzte Standards gibt (wie keine HTML-Mails
zu versenden, keine Attachments an Mailinglisten zu schicken, bestimmte
Formalia einzuhalten, sich kurz zu fassen, etc.) und die sich inzwischen
neben Telephon, Fax und Brief als schnelles, asynchrones Kommunikationsmedium
eine eigene Existenzberechtigung geschaffen hat.
Es liegt jedoch nahe festzustellen, dass sich netzspezifische
Kommunikationsformen bisher noch nicht in der Weise kulturell etabliert
haben, wie wir es von den anderen Medien her kennen. Ein Indiz dafür
ist, dass jeder Chatroom, jede Mailingliste oder Newsgroup ihre eigenen
Regelwerke formuliert. Für die Verwendung anderer technischer Medien
oder im face-to-face-Gespräch brauchen wir dies nicht mehr. Hier haben
wir deren Funktionsweisen völlig internalisiert, so dass es überflüssig
ist, die Regeln explizit zu formulieren. Derzeit haben wir - vielleicht
mit Ausnahme der E-Mail - also weder klare kulturelle Funktionen der
vernetzten Kommunikationsmöglichkeiten definiert noch wirklich gut
funktionierende Formen gefunden, die den Leistungen der anderen Medien
nahekommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Netz deswegen untauglich
ist, sondern es heißt vor allem, dass wir weiterhin intensiv an den
Gestaltungsmöglichkeiten arbeiten müssen. Bis sich ähnliche Standards
etabliert haben, wie wir sie aus den anderen Medien kennen, wird vermutlich
noch einige Zeit vergehen.
Vernetzte Information
Auf einer anderen Ebene finden wir ähnliche Probleme in der Informationsorganisation
und -darstellung im World Wide Web. Müßig zu betonen, dass sich der
Computer materiell wesentlich vom Buch unterscheidet - insbesondere
darin, dass er Daten nach vorgegebenen Paradigmen (sprich: Softwareprogrammen)
interpretieren kann. Das, was also am Bildschirm dargestellt wird,
sind schon interpretierte Daten, auch die Browser, die man für das
WWW nutzt, sind Interpretationsprogramme. Für den normalen Benutzer
sind die Kriterien, nach denen die Daten dargestellt werden, nicht
durchschaubar. Wie jedoch Informationen medienspezifisch aufbereitet
werden können, ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. Das Feld der
Informationsvisualisierung steht paradigmatisch für Forschungen in
diesem Bereich. Die Geisteswissenschaften tun sich hier besonders
schwer: Sie sind meist ausgesprochen textlastig, da sie sich gemeinsam
mit dem Medium Buch entwickelt haben, und können sich vorerst kaum
von Textwüsten lösen - allerdings (und diese Erfahrung werden viele
von Ihnen gemacht haben) scheint der Bildschirm nicht das adäquate
Medium für intensives Lesen zu sein.
Ein weiterer Aspekt, der gleichzeitig zu den Stärken des Netzes gehört,
ist in unserer Wahrnehmung aber nach wie vor ein Problem: Die fehlenden
Qualitätsstandards. Jeder, der über die entsprechende technische Ausrüstung
verfügt, kann Informationen ins Netz stellen - jedoch fällt das zentrale
Regulativ, über das die Massenmedien verfügen, weg. Es gibt für den
Benutzer zunächst keine sichtbaren Kriterien, nach denen er den Wert
der Informationsmassen für sich einschätzen kann.
Auch hier geht es also darum, Standards für die Informationsdarstellung,
aber auch - analog zur Entwicklung im Buchdruck - für deren Rezeption
zu entwickeln, die weder die Freiheit noch die Polydirektionalität
des Netzes einschränken noch jedoch der Willkür und Individualisierung
von Wissen Tür und Tor öffnen.
Prinzipiell stehen wir also vor dem Problem, die
Stärken und Schwächen des Netzes auszutarieren und Kommunikations-
sowie Informationsformen zu entwickeln, die es uns möglich machen,
die Stärken des Internets zu nutzen. Wenn wir dies tun, dann müssen
sich vermutlich gleichzeitig unsere Wertvorstellungen verschieben
- z.B. im Hinblick auf die Akzeptanz kollektiver, interaktionsintensiver
Arbeitsformen einerseits und individualisierter, aber transparenter
Informationsformen andererseits. Dabei stehen wir jedoch vor dem Dilemma,
dass wir vorerst nach Kategorien vorgehen, die von anderen Medien
geprägt sind. Damit sich die Stärken des Netzes durchsetzen können,
sind einige grundlegende Verschiebungen kultureller Paradigmen notwendig.
Was haben diese Bemerkungen nun mit der Netzkunst
zu tun? Netzkunst ist - nach meiner Definition - Kunst, die sich der
Computernetze bedient und sie zu ihrer Existenzbedingung macht. Das
heißt, sie nutzt die Vernetzung für die künstlerische Produktion und/oder
die künstlerische Darstellung. Die Funktionsteilung in Kommunikations-
und Informationsmedium setzt sich hier fort: Die meisten künstlerischen
(wobei ich unter "künstlerisch" zunächst auch literarische
Projekte subsumiere) Projekte konzentrieren sich entweder auf die
Kommunikationsmöglichkeiten oder auf die Möglichkeiten vernetzter
Informationsdarstellung. In Anbetracht der oben ausgeführten These,
dass wir erst am Anfang der Entwicklung stehen, wird deutlich, dass
die Netzkunst eine wesentliche Rolle dabei spielen kann, die Grenzen,
aber auch die Stärken des Netzes deutlich zu machen. Warum? Pragmatische
Anwendungen des Netzes haben den Nachteil, dass sie häufig versuchen,
an anderen Medien entwickelte Prinzipien auf das neue Medium zu übertragen.
Dies kann in allen möglichen Bereichen beobachtet werden. Die Krise
des e-commerce ist nur ein Beispiel dafür, dass Marktprinzipien der
Industriegesellschaft offensichtlich nicht eins zu eins ins Netz übertragen
werden können. Ähnliches gilt für die Versuche, vernetztes Arbeiten
in Unternehmen zu etablieren. Im Bereich der Kunst sieht es nun etwas
anders aus: Die Medienkunst - damit meine ich die Kunst, die mit elektronischen
Medien arbeitet - hat eine lange Tradition. Insbesondere seit der
Entwicklung von Fernsehen und Video liegt einer ihrer Schwerpunkte
in der Reflexion der Möglichkeiten der Medien. Ähnliches ist bei der
Netzkunst zu beobachten. Auch sie reflektiert ihr Medium und experimentiert
mit dessen Möglichkeiten. Dabei lassen sich grob drei Schwerpunkte
der Netzkunst unterscheiden:
- Projekte, die mit kollektive/dialogischen Produktionsformen arbeiten
(Produktionsästhetik)
- Projekte, die nach medienspezifischen Darstellungsformen suchen
(Darstellungsästhetik)
- Projekte, die sich mit der Struktur des Mediums beschäftigen (Medienästhetik)
Auf jeden dieser Bereiche möchte ich im folgenden
kurz eingehen.
3. Netzkunst I: Produktionsästhetik
Eine der Ursprungsideen, die hinter der Entwicklung des Internets
(damals noch ARPANETs) standen, bestand darin, globale vernetzte Kommunikationsmöglichkeiten
zu schaffen. Diese Idee inspirierte auch die Kunst, die sich im und
mit dem Internet zusammen entwickelte. Schon vor der Entstehung des
WWW wurden Telekommunikationsmedien, auch das Internet, für kollektive
Projekte genutzt. Die Idee selber, das bürgerliche Paradigma des genialen
Einzelkünstlers, das lange die Ästhetik beherrschte, zu durchbrechen,
ist wiederum viel älter. Spätestens seit der Romantik wurde immer
wieder versucht, interaktionsintensive Kunstformen zu entwickeln;
als Beispiele seien hier nur die Idee des Gesamtkunstwerks von Wagner
als einem intensiven Zusammenspiel zwischen Künstlern, aber auch zwischen
Kunst und Publikum, genannt,[8] aber auch z.B.
Novalis' Begriff der "Coactivität" aller bei der Poetisierung
der Welt.[9] Zum Programm
wurde die Idee einer kollektiven Kreativität jedoch erst in den Avantgarden
des 20. Jahrhunderts - einerseits in den 10er und 20er Jahren, insbesondere
im Bereich des Theaters (z.B. im Kontext des politischen Theaters
Erwin Piscators), andererseits in den 60er Jahren, insbesondere in
dern Happening- und Aktionskunst. Es ist jedoch interessant, dass
sich derartige Konzepte in dieser Zeit nur unter den Bedingungen zeitlicher
und räumlicher Präsenz tatsächlich auch umsetzen ließen. Insofern
hatte es insbesondere die Literatur schwer, ihre Visionen tatsächlich
umzusetzen - sie wurde letztlich immer wieder auf das interaktionsarme
Medium Buch zurückgeworfen und scheiterte letztlich an dessen Materialität.
Dies ändert sich nun mit dem Internet, insbesondere mit dem WWW.
Die ersten künstlerischen Projekte, die sich im WWW entwickelten,
waren tatsächlich Projekte, die mit Formen kollektiver Produktion
spielten. Inzwischen haben sich verschiedene Subformen kollektiver
Kreativität herausgebildet, die sich in erster Linie in der Strukturierung
ihres Entstehungsprozesses unterscheiden. Dabei unterscheide ich
- kooperative Projekte
- kollaborative Projekte
- dialogische Projekte
Bisher oszillieren deren Strukturen noch zwischen der Übertragung
von Prinzipien der Buchkultur ins Netz (Abhängigkeit) und der völligen
Negierung jeglicher buchkultureller Standrds (Gegenabhängigkeit).[10]
So halten viele Projekte, die sich in Abhängigkeit von den Traditionen
der Buchkultur bewegen, z.B. am Paradigma der Identifizierbarkeit
von Einzelautoren fest, so dass jeder Beitrag mit Autorenname gekennzeichnet
ist. Mitschreibeprojekte (wie z.B. "Beim Bäcker", eine der
frühesten deutschen Mitschreibeinititiven), bei denen eine Geschichte
gemeinsam weiterentwickelt wird, sind häufig so strukturiert. Derartige
Projekte zähle ich zu den kooperativen. Sie unterscheiden sich in
der Struktur ihres Entstehungsprozesses nicht wesentlich von der Buchkultur,
da nach wie vor jeder alleine schreibt, auch wenn er Anregungen früherer
Texte aufnimmt. Meist beschränken sie sich auch auf eine weitgehend
lineare, klassische Textdarstellung.
Einige Projekte jedoch verzichten völlig auf jede Identifikation,
so dass für den Rezipienten nicht mehr nachzuvollziehen ist, wer nun
was wozu beigetragen hat. Derartige Projekte bezeichne ich als kollaborativ
- "The Worlds
First Collaborative Sentence" von Douglas Davis ist eines
der frühesten Beispiele hierfür. Hier kann jeder spontan beitragen,
ohne dass eine Kontrollinstanz eingreift. Dies führt jedoch dazu,
dass das Projekt (und das gilt nicht nur für dieses) für reine Rezipienten
kaum mehr nachvollziehbar ist, weil der Willkür der Teilnehmer völlig
freien Raum gelassen wird und keinerlei Strukturierung in der Textdarstellung
stattfindet.
Die dritte große Gruppe bezeichne ich als dialogische Projekte - es
sind dies Initiativen, die auf der synchronen Gruppenkommunikation
beruhen. Im Vergleich zu den vorangegangenen Projekten versuchen sie,
neue netzspezifische Arbeitsformen zu etablieren, die auf den polydirektionalen
Kommuikationsmöglichkeiten des Netzes beruhen, allerdings - im Gegensatz
zu Kooperation und Kollaboration - nur synchron, also unter der Bedingung
der gleichzeitigen Anwesenheit aller Teilnehmer (wenn auch an verschiedenen
Orten), funktionieren. Das Schreibnetz
Hamburg hat einige solcher Experimente durchgeführt, aus denen
durchaus lesbare Geschichten entstanden sind, die jedoch gleichzeitig
die Mängel der Chatkommunikation deutlich zutage treten lassen. Der
Chatkrimi "Tatort Eppendorf"
mag hier als Beispiel dienen. Hier gibt es Passagen, bei denen deutlich
wird, dass teilweise Überkreuzkommunikationen stattgefunden haben,
wenn ein Teilnehmer auf etwas eingeht, das jemand anderes schon
kommentiert und in eine andere Richtung gelenkt hat.
Dies scheint im übrigen das Hauptproblem kollektiver Projekte zu sein:
Meistens steht die Produktionsdynamik zwischen den Teilnehmern im
Vordergrund, nicht das Produkt. Daher laufen derartige Projekte Gefahr,
zum kommunikativen Selbstzweck zu werden, der für Nicht-Beteiligte
kaum von Interesse ist. Das zweite große Problem - insbesondere von
Mitschreibeprojekten - ist das Engagement der Teilnehmer. Meistens
erfreuen sich die Projekte anfangs großer Aktivitäten, die aber zunehmend
abflauen. Der Grund dafür liegt m.E. nicht zuletzt darin, dass insbesondere
kooperative Projekte noch auf Produktionsformen der Buchkultur basieren,
der Einzelne also nach wie vor alleine schreibt, auch wenn er auf
Ideen seiner "Vorschreiber" zurückgreift und sie einarbeitet.
Die kollektiven Projekte spiegeln damit die Probleme des vernetzten
Arbeitens. Sie oszillieren zwischen der Übertragung von Prinzipien
der Buchkultur, also der individuellen Produktion, und der völligen
Negierung dieser Prinzipien, die meist im nicht mehr nachvollziehbaren
Chaos endet. Es wäre daher notwendig, die Bedingungen vernetzten Arbeitens
kritisch zu durchleuchten und ebenso die Möglichkeiten des Mediums
zu hinterfragen. Das Internet eignet sich nicht für jede Form gemeinsamen
Arbeitens. Die dialogischen Projekte scheinen bei der Suche nach produktiven
vernetzten Arbeitsformen am weitesten fortgeschritten zu sein, stoßen
aber noch auf mannigfaltige Probleme, die es in Zukunft zu lösen gilt,
um - auch unabhängig vom künstlerischen Kontext - die vernetzte Gruppenkommunikation
produktiv zu gestalten.
Darüber hinaus wird es in Zukunft darum gehen herauszufinden, wie
das Netz für kollektive Produktion zu nutzen ist und wie die Prozesse
und Resultate adäquat dargestellt werden können, so dass sie für Nicht-Beteiligte
nachvollziehbar sind. Hier stehen wir erst am Anfang - und natürlich
hängt die Entwicklung vernetzter Arbeitsformen eng mit der technologischen
Entwicklung zusammen.
4.
Netzkunst 2: Darstellungsästhetik
Ein ähnlicher Spannungsbogen zwischen Übertragung von Darstellungsprinzipien
aus anderen Medien und experimenteller Radikalität in der Negierung
alter Standards lässt sich in bezug auf die Suche nach medienspezifischen
Darstellungsformen feststellen. Die bisher gezeigten Beispiele arbeiteten
z.B. alle mit linearer Textdarstellung. Die Alternative dazu lag in
der literarischen Produktion bisher meistens in der Nutzung des Hypertextes.
Mittlerweile jedoch hat sich große Skepsis bezüglich der Konzeption
von sogenannten "Hyperfictions" breitgemacht - "Hyperfictions"
ist die Bezeichnung für Werke, die nach dem Vorbild des Romans funktionieren,
jedoch mit einzelnen, durch Hyperlinks vielfach miteinander verbundenen
Textsegmente arbeiten. Der Leser kann so mehrere Lesewege beschreiten,
die möglicherweise jeweils andere Geschichten ergeben. Aufgrund der
Intransparenz der Linksetzung, die auf dem Willen des Autors beruht,
muss der Leser eigentlich das Denken des Autors nachvollziehen, ohne
sein Wissen - sprich: seine Kenntnis der Geschichte(n) zu haben. Hyperfictions
orientieren sich noch weitestgehend an den Prinzipien der Buchkultur
- Einzelautorschaft, abgeschlossene Werke, etc. - und gehören daher
in die Kategorie der abhängigen Projekte.
In der Netzkunst lassen sich jedoch mittlerweile zahlreiche Beispiele
finden, die andere, sich vom Text entfernende Schwerpunkte setzen.
Deutlich zu beobachten ist dabei eine Tendenz zur Visualisierung des
Textes - eingedenk meiner obigen Bemerkung, dass der Bildschirm sich
vermutlich nicht in dem Maße zum intensiven Lesen eignet wie das Buch.
"The Great Wall of China"
von Simon Biggs thematisiert diese Frage. Sein Projekt beruht auf
einer unvollendeten Erzählung von Franz Kafka, "Beim Bau der
Chinesischen Mauer". Der Text transformiert sich unter der Maus
des Benutzers auf der Basis einer Datenbank, in der alle Wörter der
Erzählung eingespeist sind. Nach festgelegten Syntaxregeln werden
Sätze generiert, die allerdings nicht unbedingt sinnvoll zu nennen
sind. Aufgrund der rasend schnellen Transformationsprozesse wird es
für den Benutzer quasi unmöglich, den Text zu lesen - und selbst wenn
er mit der Maus aus dem Text herausgeht, stellt sich die Frage, wie
sinnvoll es ist, einen zufällig generierten Textabschnitt so zu lesen,
als wäre es ein von einem Autor intendierter Text.
Diese Subversion des klassischen, aus dem Buch ins Netz übertragenen
Leseverhaltens ist der eine Aspekt des Projekts. Der Verlust der Lesbarkeit
geht einher mit einer Funktionsveränderung des Textes: Er erhält visuelle
Qualitäten, zugleich findet sich der einstige Leser in der Rolle eines
Spielers wieder, der die Interaktivitätsmöglichkeiten des Projektes
nutzt. Darüber hinaus wird das Autorenindividuum aufgelöst: Man kann
nicht mehr genau sagen, wer nun Urheber des Projektes ist: Der Programmierer?
Der "Konzeptor"? Oder doch der Benutzer, der durch seine
Aktivität den Text erzeugt? Es scheint nur eines sicher zu sein: Dass
der Autor des gedruckten Textes, aus dem das Material stammt, nämlich
Franz Kafka, seine Autorenfunktion hier verliert. Biggs subvertiert
mit diesem Projekt eindeutig die Prinzipien der Buchkultur und deutet
an, dass das Netz auf anderen Darstellungs- und Generierungsparadigmen
beruht - die es jedoch erst noch zu entwickeln gilt.
Mit neuen Darstellungsformen von Text
befasst sich auch Steve Cannons ambitioniertes Projekt "text.ure". Es koppelt die Visualisierung
von Textstrukturen mit dem Text selber, wobei letzterer zwangsläufig
in den Hintergrund gerät. "text.ure" experimentiert in erster
Linie mit dem Verhältnis zwischen Software, Sprache und Design. Darüber
hinaus koppelt es die kollaborative Textproduktion mit komplexer Programmierung.
Als Rezipient muss man ein erhöhtes Maß an Experimentierbereitschaft
und Geduld aufbringen, um das Projekt zu verstehen. Zunächst gilt
es, die Navigationskriterien zu durchschauen, die einerseits an eine
Topographie, andererseits an arbiträre Parameter gekoppelt sind: Die
Textdatenbank wird als topographische Landkarte mit Erhebungen und
Ebenen dargestellt, über die man mit dem Cursor fahren kann. Die "Berge"
und "Täler" repräsentieren einen bestimmten Ort in der Datenbank
und damit auch ein Textsegment. Neben der topographischen Karte nimmt
der Leser seinen Weg durch die Segmente, die rechts als Text abgebildet
sind, auch "linear" wahr. Von der in der Datenbank gespeicherten
Geschichte gibt es mehrere Versionen - je nach Cursorbewegung wird
eine in diesem "Terrain" befindliche Version angezeigt.
Es existieren verschiedene "Ebenen" mit Variationen
der erzählten Geschichte. Der Rezipient kann über das Eingabetool
Variationen hinzufügen und damit neue Ebenen kreieren, die wiederum
die angezeigten Visualisierungen verändern.
Cannons Projekt ist ein Paradebeispiel für den Aspekt, den ich oben
schon einmal kurz erwähnt habe: Es arbeitet mit einer eigenen Programmierung
und damit mit Prinzipien, die für den Benutzer schwer durchschaubar
ist. Diese Intransparenz führt dazu, dass das Projekt bis zu einem
gewissen Grade unverständlich bleibt bzw. erst nach längerer Beschäftigung
in seinen einzelnen Funktionen erschlossen werden kann. Die Kriterien,
nach denen der Text visualisiert wird, sind willkürlich gesetzt. Als
Experiment ist "text.ure" interessant, weil es deutlich
macht, wie wenig derartige Projekte auf bestehende Standards zurückgreifen
können. Das Lesen eines Buches kann zwar auch Arbeit sein, indem man
sich die Struktur und den Inhalt erschließen muss; die Kriterien,
nach denen es funktioniert, sind jedoch klar: Man beginnt am Anfang,
die Seiten sind numeriert, es gibt Kapitel, der Leseweg ist vorgegeben,
kurz: Das Programm, nach dem man sich dem Medium nähert, ist völlig
standardisiert. Und wenn es durchbrochen wird, wie in einigen avantgardistischen
Romanen, dann kann man als Leser damit umgehen, weil man die Grundsätze
kennt, gegen die verstoßen wird. Anders sieht es hier aus: Cannon
bricht mit jeglicher bekannten Art der Textdarstellung, indem er Visualisierung,
Text und Benutzeraktivität miteinander koppelt - auf eine Art und
Weise, die für den Benutzer - zumindest zunächst - intransparent ist.
Biggs' Projekt dagegen ist - trotz der Intransparenz der Funktionsweise
der Datenbank - leichter zu verstehen, weil er explizit auf die Standards
der Buchkultur rekurriert und diese bricht.
Die beiden Beispiele sollen deutlich machen, dass wir - ähnlich wie
bei der Kommunikation - erst am Beginn der Suche nach medienspezifischen
Darstellungsformen stehen. Gerade in diesem Bereich wird auch deutlich,
wie wichtig es ist, gewisse Medienkompetenzen zu erwerben, um adäquat
mit dem Medium umgehen zu können. Vermutlich werden dazu auch gewisse
Kenntnisse in den Prinzipien der Programmierung gehören, ebenso aber
Funktionsveränderungen der klassischen Codes und damit einhergehend
eine Umstellung des Wahrnehmungsverhaltens. Vermutlich wird sich die
Textpräsentation grundlegend verändern - kürzere Textabschnitte, Dynamik,
Visualisierung des Textes, auch automatische Generierung bestimmter
Textsequenzen. Möglicherweise wird das Datenbankprinzip große Bedeutung
erlangen, was bedeutet, dass die Kriterien, die es möglich machen,
Datenbanken zu durchsuchen und sich Ergebnisse anzeigen zu lassen,
die Generierung von Wissen grundlegend beeinflussen werden und daher
zum momentanen Zeitpunkt transparent gemacht werden müssen, damit
sich die Benutzer die notwendigen Kompetenzen aneignen können.
Computer und Internet bleiben dabei natürlich nach wie vor Medien
unter vielen anderen. Das bedeutet wiederum, dass es nicht um eine
Ablösung von z.B. buchkulturellen epistemologischen Kriterien durch
netz- oder computerspezifische Informationsdarstellungs- und -verarbeitungsformen
geht, sondern darum, dass zwischen den verschiedenen Programmen der
Medien oszilliert werden muss. Damit dies möglich wird, müssen Computer
und Internet allerdings bestimmte festgelegte kulturelle Standards
entwickeln, die für die Benutzer zur Selbstverständlichkeit werden.
5. Netzkunst III: Medienästhetik
Zum Abschluss dieser kleinen Tour durch die Netzkunst möchte ich noch
kurz auf den dritten Bereich der Netzkunst eingehen: die selbstreferentielle
Medienkunst, die versucht, die Struktur des Mediums transparent zu
machen und damit quasi eine "pädagogische" Aufgabe übernimmt:
Nämlich den Blick für die Notwendigkeiten im Umgang mit dem Medium
zu schärfen. Als Beispiel soll hier "%Location" von Jodi fungieren.
Die Webseite zeigt ein Konglormerat an ASCII-Zeichen, die völlig willkürlich
und unverständlich erscheinen. Wo ist hier die Kunst? werden Sie sich
vermutlich fragen. Das Projekt erschließt sich erst, wenn man auf
die Idee kommt, sich den Quellcode anzuschauen: Plötzlich ordnet sich
das Chaos der Oberfläche zu klaren topographischen Zeichnungen. Fast
alle Projekte von Jodi machen die verschiedenen symbolischen Schichten
des Computers zum Thema und spielen mit der Intransparenz des Mediums
für den Benutzer. Wer weiß schon, was wirklich passiert, wenn man
auf einen Link clickt? Dass dann eine ganze Reihe an Prozessen in
Gang gesetzt wird, bleibt unsichtbar. "%Location" verdeutlicht
die Vielschichtigkeit und Komplexität des Mediums - ebenso wie die
Fragilität der Browser-Darstellungen. Denn erst wenn man die Browser-Interpretation
ausschaltet, indem man den Quelltext ansieht, offenbart das Projekt
seine Bedeutung.
6. Oszillation als kultureller
Prozess
Die Netzkunst diente hier nicht nur als Beispiel für die Probleme,
die sich bei der kulturellen Etablierung eines neuen Mediums beobachten
lassen. Sie ist zwar einerseits ein Spiegel der kulturellen Entwicklung,
andererseits kann sie aber auch Impulse geben, indem sie die Reflexion
über das Medium fördert und eventuell sogar mögliche Lösungen andeutet.
Dies ist deshalb so wichtig, weil es nicht zuletzt in unserer Hand
liegt, die Zukunft des Mediums mitzugestalten und unsere Bedürfnisse
zu formulieren. Angesichts des harten Kampfes der Soft- und Hardware-Unternehmen
um technische Monopole scheint dies zwar etwas idealistisch formuliert
zu sein, dennoch bin ich davon überzeugt, dass Medien, die auf Dauer
keinen sichtbaren Nutzen für die Gesellschaft haben, auch nicht überleben
werden. Die Nutzungsmöglichkeiten des Internets liegen auf der Hand
und ich hatte sie eingangs schon erwähnt:
- zeit- und raumunabhängige polydirektionale (Gruppen-)Kommunikation
- schneller Zugriff auf Informationen einerseits, aber auch neue
Potentiale der Wissensgenierung durch veränderte Formen der Informationsgenerierung,
-darstellung und -verarbeitung.
Ansätze, wie diese Potentiale genutzt werden können, sind schon vorhanden,
jedoch befinden sie sich meist entweder in Abhängigkeit oder in Gegenabhängigkeit
zu Programmen anderer, etablierter Medien. Der nächste Schritt wäre
der zur Autonomie des Mediums - eben die Entwicklung von Nutzungsformen,
die nur das Netz bieten kann, und der Ausbau der Potentiale zum produktiven
und gleichzeitig auch selbstverständlichen Umgang mit dem Medium.
Konkret heißt das zum einen, Formen der (Gruppen-)Kommunikation auszubilden,
die sicher anders funktionieren werden, als die bisher bekannten Kommunikationsformen,
aber entsprechend effektiv für bestimmte Zwecke sein können - wie
z.B. die Bearbeitung bestimmter Aufgaben mittels vernetzter Arbeitsplattformen.
Zum anderen geht es darum, Computer und Internet - ähnlich wie es
beim Buchdruck geschehen ist - für die Informationsgenerierung, -darstellung
und -verarbeitung fruchtbar zu machen, und zwar unter Ausbildung neuer
medienspezifischer Kriterien.
Dabei bleibt festzuhalten, dass das Internet sich immer im Verbund
mit anderen Medien befinden wird und daher die Oszillation zwischen
verschiedenen medialen Programmen zu einer grundlegenden kulturellen
Kompetenz wird. "Oszillation" bedeutet ganz konkret einen
kulturellen Prozess, der es ermöglicht, die Vielfalt von Phänomenen
und Praktiken gleichermaßen zu nutzen, ohne eines oder eine zu prämieren
und andere in den Hintergrund zu drängen.[11]
Wie anfangs erwähnt, tendierte unsere Kultur in den letzten Jahrhunderten
dazu, bestimmte Kommunikations- und Wahrnehmungsformen zuungunsten
anderer zu bevorzugen und positiv zu bewerten. Dies betrifft die Prämierung
der interaktionsarmen Kommunikation sowie die Standardisierung der
Wahrnehmung z.B. durch zentralperspektivische Sichtweisen. Das Internet
könnte und wird hoffentlich dazu führen, dass in Zukunft eine Vielfalt
verschiedener Formen möglich wird, zwischen denen man oszillieren
kann:
- In bezug auf die Arbeitsformen wird demnach eine Oszillation zwischen
selbstorganisierten und extern gesteuerten sowie zwischen kollektiven
und hierarchisch organisierten Interaktionsformen notwendig;
- Ebenso tritt man ein in die Oszillation zwischen Programmen der
elektronischen Wissensgenerierung und -organisation und den klassischen
Wissensstandards der anderen Medien.
- Und schließlich wird man Oszillationen zwischen den verschiedenen
Programmen technischer Vernetzungs-, Massen- und Individualmedien
sowie leiblicher Medien herausbilden müssen.
Sobald das Netz derart autonom geworden ist, dass sich diese Oszillationen
als selbstverständlich eingespielt haben, wird sicher auch deutlich
werden, dass das Netz seine Paradigmen - z.B. die der kollektiven
Arbeitsformen - als kulturell relevant durchgesetzt hat. Wenn dies
der Fall ist und die wir unsere Gestaltungspotentiale gut genutzt
haben, könnten interaktionsintensive Kommunikations- und Arbeitsformen
sowie neue Wissensformen die Gesellschaft wesentlich - möglicherweise
hin zu einer Netzwerkgesellschaft, die durch Oszillationsprozesse
gekennzeichnet ist, verändert haben.